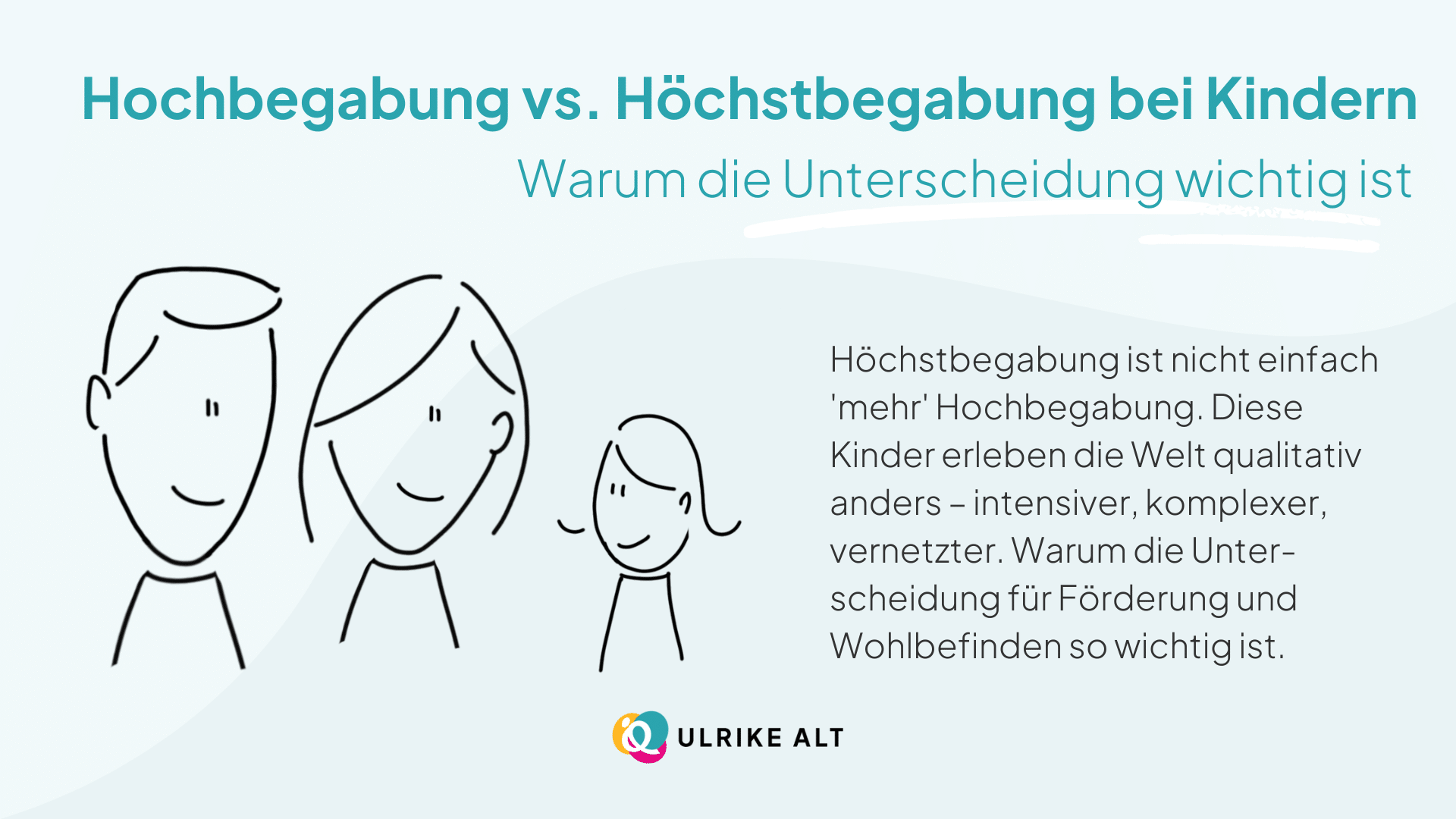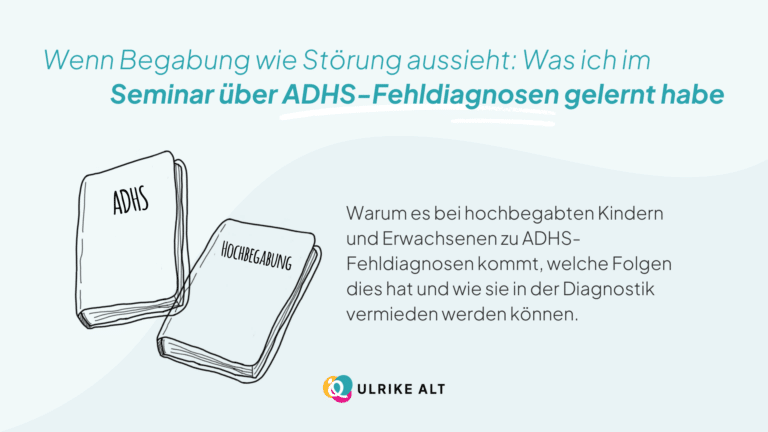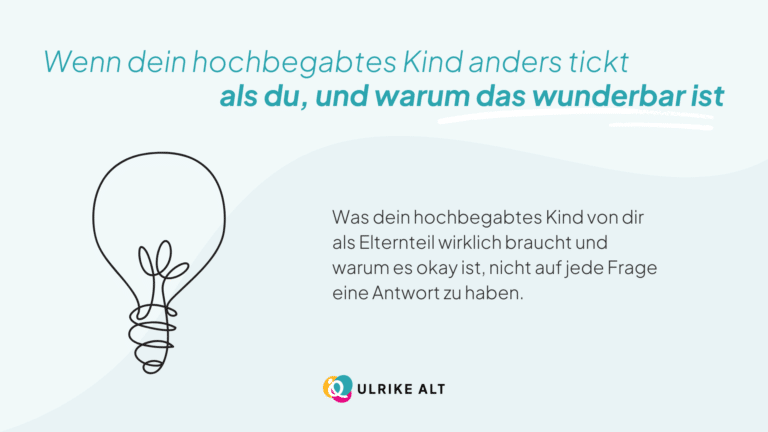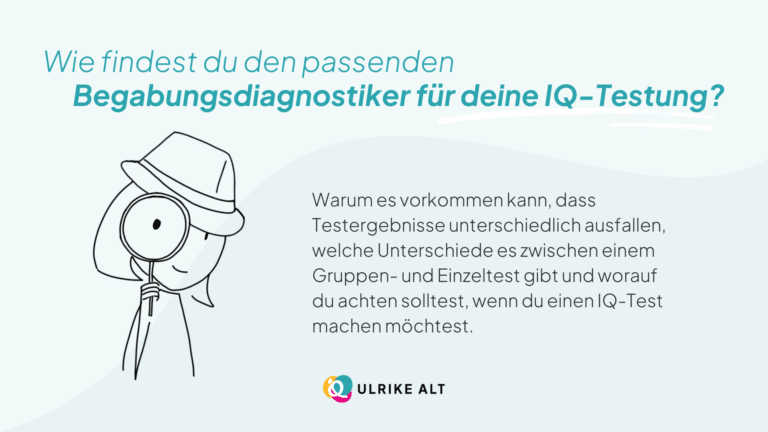Nachdem ich in einem vorherigen Blogbeitrag die Unterschiede zwischen Hochbegabung und Höchstbegabung bei Erwachsenen beleuchtet habe, erreichten mich viele Fragen von Eltern und Pädagogen: Gibt es diese Unterschiede auch bei Kindern? Und wenn ja, warum ist es wichtig, hier zu differenzieren?
Die kurze Antwort: Ja, bei Kindern zeigen sich die Unterschiede sogar oft noch deutlicher als bei Erwachsenen. Und ja, die Differenzierung kann entscheidend sein für die Entwicklung und das Wohlbefinden dieser Kinder.
Warum bei Kindern die Unterschiede oft deutlicher sichtbar sind
Kinder haben im Gegensatz zu vielen Erwachsenen noch keine ausgefeilten Strategien entwickelt, um sich anzupassen oder ihre Besonderheiten zu maskieren. Sie zeigen ihre Andersartigkeit oft ungefiltert, was einerseits die Identifikation erleichtert, andererseits aber auch zu Missverständnissen und Problemen führen kann.
Während hochbegabte Erwachsene gelernt haben, ihre Denkgeschwindigkeit zu drosseln oder ihre Interessen anzupassen, erleben hochbegabte und vor allem höchstbegabte Kinder ihre Welt noch unmittelbarer. Das macht die qualitativen Unterschiede zwischen den beiden Gruppen besonders sichtbar.
Konkrete Unterschiede im Kindesalter
Im Spielverhalten
Hochbegabte Kinder suchen sich häufig ältere Spielpartner und bevorzugen komplexere Spiele. Sie bauen nicht einfach mit Lego, sondern konstruieren nach Plan oder entwickeln eigene komplexe Bauwerke. Sie spielen Brettspiele, die eigentlich für ältere Kinder gedacht sind, und erfassen die Regeln intuitiv.
Höchstbegabte Kinder hingegen haben oft Schwierigkeiten, überhaupt Spielpartner zu finden. Ihre Spielideen sind so komplex, abstrakt oder unkonventionell, dass selbst ältere Kinder nicht folgen können oder wollen. Ein höchstbegabtes Kind möchte vielleicht ein Spiel erfinden, das verschiedene physikalische Prinzipien integriert, während Gleichaltrige noch „Fangen“ spielen möchten. Das kann zu Frustration und Einsamkeit führen.
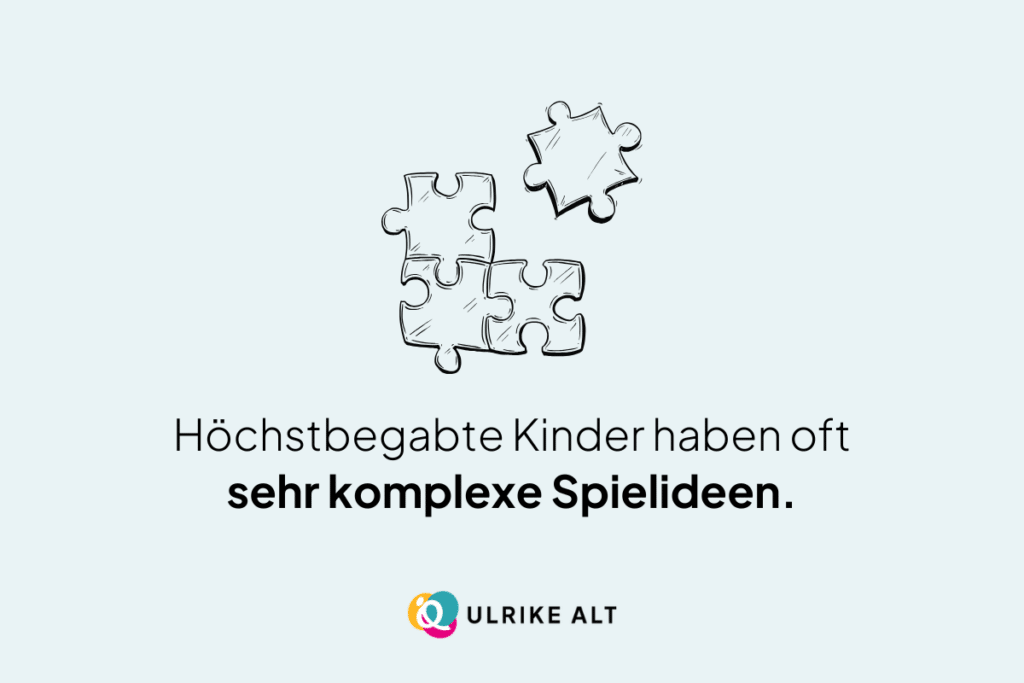
In der sprachlichen Entwicklung
Hochbegabte Kinder sprechen oft früh und verfügen über einen differenzierten Wortschatz. Sie formulieren in ganzen Sätzen, wenn andere noch in Zwei-Wort-Kombinationen sprechen. Sie lieben Wortspiele und verstehen komplexe Sprachstrukturen früh.
Höchstbegabte Kinder zeigen ein paradoxes Phänomen: Einerseits können sie sprachlich sehr weit entwickelt sein, andererseits stellen sie bereits im Vorschulalter existenzielle Fragen, für die ihnen selbst die sprachlichen Mittel fehlen. „Mama, was passiert, wenn das Universum zu Ende ist?“ oder „Warum ist Ungerechtigkeit überhaupt möglich?“ sind Fragen, die Vierjährige stellen – und dann frustriert sind, weil die Antworten der Erwachsenen sie nicht zufriedenstellen oder weil sie ihre eigenen komplexen Gedanken nicht ausdrücken können.
In der Schule und beim Lernen
Hochbegabte Kinder langweilen sich oft in der Schule, können aber noch Teile des Unterrichts als interessant erleben. Sie freuen sich über neue Themen, auch wenn sie diese schnell durchdrungen haben. Mit entsprechender Förderung (Enrichment, Akzeleration) lässt sich oft eine gute Balance finden.
Höchstbegabte Kinder erleben häufig massive Unterforderung, die sich nicht durch „ein bisschen mehr“ oder „etwas schwierigere Aufgaben“ kompensieren lässt. Sie verstehen Konzepte oft intuitiv und in ihrer ganzen Tiefe, noch bevor sie erklärt werden. Die Diskrepanz zwischen ihrem inneren Erleben und dem Schulalltag kann so groß sein, dass sie Verweigerungshaltungen entwickeln, als „verhaltensauffällig“ gelten oder psychosomatische Beschwerden entwickeln.
Ein höchstbegabtes Kind sagte mir einmal: „Ich sitze da und warte, dass endlich was Interessantes kommt. Aber es kommt nie.“
Im emotionalen Erleben
Hochbegabte Kinder zeigen oft eine hohe emotionale Intensität und ausgeprägte Empathie. Sie weinen bei traurigen Geschichten, empören sich über Ungerechtigkeit und können sich stark in andere hineinversetzen. Ihre Gefühle sind intensiv, aber in der Regel auf konkrete Erlebnisse oder Personen bezogen.
Höchstbegabte Kinder können von ihren eigenen Emotionen regelrecht überwältigt werden. Sie reagieren emotional auf abstrakte Konzepte: Ein Kind weint, weil es über die Endlichkeit des Universums nachdenkt. Ein anderes kann nicht schlafen, weil es sich Gedanken über Umweltzerstörung macht – oder es erlebt mathematische Schönheit so intensiv, dass es zu Tränen gerührt ist. Diese emotionale Reaktion auf Abstraktes ist ein Kennzeichen, das bei Höchstbegabung besonders ausgeprägt ist.
In sozialen Beziehungen
Hochbegabte Kinder finden oft einige Gleichgesinnte, mit denen sie sich austauschen können. Sie mögen zwar anders sein als die Mehrheit, aber es gibt in der Regel ein paar Kinder in der Klasse oder in außerschulischen Aktivitäten, mit denen eine Verbindung möglich ist.
Höchstbegabte Kinder fühlen sich oft schon im Kindergarten- oder Grundschulalter fundamental anders und unverstanden. Sie beschreiben das Gefühl, „von einem anderen Planeten“ zu sein. Selbst in Gruppen hochbegabter Kinder können sie sich isoliert fühlen. Die Seltenheit von Höchstbegabung (ca. 0,1 % der Bevölkerung im Vergleich zu 2 % bei Hochbegabung) bedeutet, dass die Chance, ein wirklich gleichgesinntes Kind zu treffen, sehr gering ist.
Warum die Unterscheidung wichtig ist
Für die kindliche Entwicklung
Die Unterscheidung zwischen Hochbegabung und Höchstbegabung ist keine akademische Spielerei, sondern hat konkrete praktische Konsequenzen:
1. Angemessene Förderung
Höchstbegabte Kinder brauchen nicht einfach „mehr vom Gleichen“. Während ein hochbegabtes Kind von Enrichment-Programmen, AGs für besonders Interessierte oder dem Überspringen einer Klasse profitieren kann, benötigen höchstbegabte Kinder oft qualitativ andere Ansätze:
- Extrem individualisierte Lernpfade
- Hohe Autonomie bei der Themenwahl
- Die Möglichkeit, in extreme Tiefe zu gehen
- Mentoren, die ihre Denkweise verstehen
- Manchmal alternative Bildungswege wie Homeschooling, Frühstudium oder spezialisierte Programme
2. Prävention von psychischen Problemen
Das Risiko für Underachievement, Depression, Angststörungen oder soziale Isolation ist bei höchstbegabten Kindern deutlich erhöht. Wenn ihre Besonderheit nicht erkannt und verstanden wird, entwickeln viele dieser Kinder das Gefühl, „falsch“ zu sein. Sie versuchen sich anzupassen, scheitern daran und ziehen den Schluss, dass mit ihnen etwas nicht stimmt.
Frühe Identifikation und angemessene Unterstützung können helfen, diese Entwicklung zu verhindern. Es geht darum, dem Kind zu vermitteln: „Du bist nicht falsch. Du bist höchstbegabt, und das bedeutet, dass du die Welt anders erlebst als die meisten Menschen. Das ist in Ordnung.“
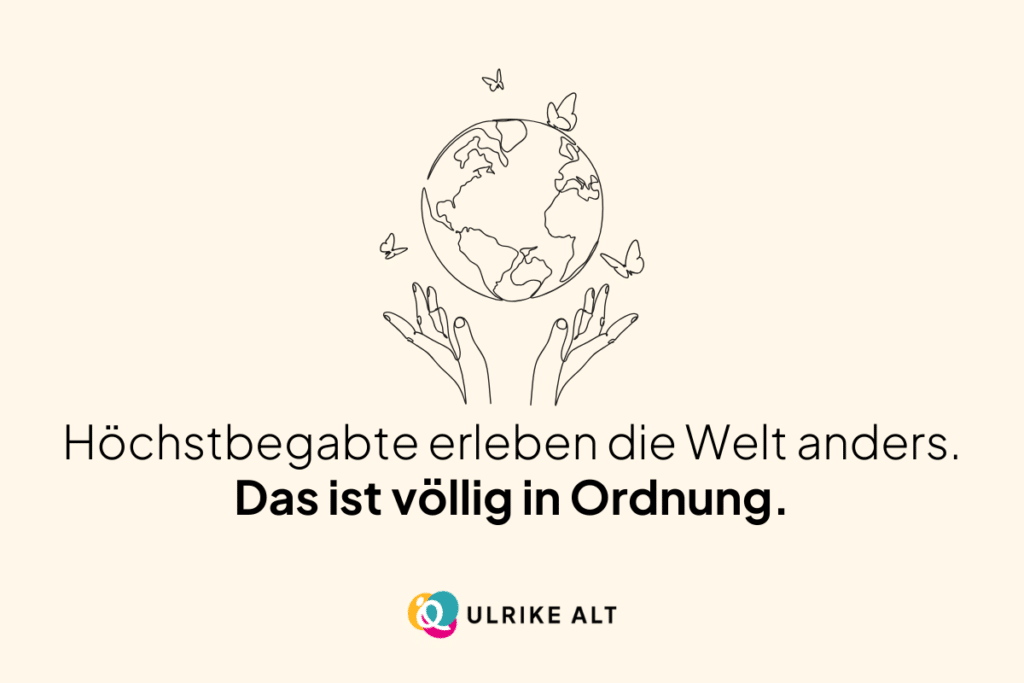
3. Unterstützung für Eltern
Eltern von höchstbegabten Kindern stehen vor besonderen Herausforderungen. Diese Kinder sind oft:
- Intensiver in ihren Bedürfnissen
- Schwieriger zufriedenzustellen
- Fordernder im Gespräch
- Anfälliger für existenzielle Krisen
Selbst hochbegabte Eltern können sich überfordert fühlen, wenn ihr Kind höchstbegabt ist. Die Intensität, mit der diese Kinder die Welt erleben und hinterfragen, kann erschöpfend sein. Eltern brauchen oft spezifische Beratung und Unterstützung, um mit diesen Besonderheiten umzugehen.
4. Realistische schulische Planung
Für hochbegabte Kinder lassen sich oft innerhalb des regulären Schulsystems Lösungen finden: Akzeleration, Drehtürmodelle, besondere AGs, Teilnahme an Wettbewerben.
Für höchstbegabte Kinder reichen diese Maßnahmen häufig nicht aus. Selbst das Überspringen von zwei oder drei Klassen löst das Problem nicht grundlegend, weil es nicht nur um den Lernstoff geht, sondern um die gesamte Art des Lernens und Denkens. Realistische Planung kann bedeuten:
- Frühzeitiger Kontakt zu Universitäten (Frühstudium)
- Individuelle Bildungsvereinbarungen
- Homeschooling mit externem Mentoring
- Internationale Programme für extrem begabte Kinder
Für das Selbstverständnis
Viele höchstbegabte Kinder entwickeln ein negatives Selbstbild, weil sie ständig die Erfahrung machen, anders zu sein, nicht verstanden zu werden und nirgendwo richtig „hineinzupassen“. Die Erkenntnis, dass sie nicht „falsch“ sind, sondern höchstbegabt, kann enorm entlastend sein.
Ich erlebe in meiner Arbeit immer wieder, wie befreiend es für Kinder (und ihre Eltern) ist, wenn sie verstehen: „Das ist bei Höchstbegabung normal. Du bist nicht allein mit diesem Erleben.“
Die Grenze nicht zu starr sehen
Bei aller Wichtigkeit der Differenzierung möchte ich betonen: Die Grenze zwischen Hochbegabung und Höchstbegabung ist fließend. Ein IQ von 144 versus 145 macht nicht automatisch einen riesigen Unterschied. Es geht weniger um exakte Zahlenwerte als um das Gesamtbild der Erlebensweise.
Manche Kinder mit einem IQ von 142 zeigen Merkmale, die eher typisch für Höchstbegabung sind, während andere mit einem IQ von 148 sich eher im Spektrum der „normalen“ Hochbegabung bewegen. Die quantitativen Unterschiede im IQ gehen oft – aber nicht immer – mit qualitativen Unterschieden im Erleben einher.
Was bedeutet das für die Praxis?
Für Eltern:
- Beobachtet euer Kind genau: Geht es um quantitative Unterschiede (schneller, mehr) oder qualitative (anders, intensiver)?
- Sucht euch Unterstützung von Menschen, die Erfahrung mit Höchstbegabung haben
- Vertraut eurem Bauchgefühl, wenn ihr spürt, dass die üblichen Empfehlungen für hochbegabte Kinder bei eurem Kind nicht greifen
- Vernetzt euch mit anderen Eltern höchstbegabter Kinder
Für Pädagogen:
- Seid offen für die Möglichkeit, dass ein Kind nicht nur hochbegabt, sondern höchstbegabt sein könnte
- Standard-Enrichment reicht für diese Kinder oft nicht aus
- Das „schwierige“ Verhalten eines höchstbegabten Kindes ist oft Ausdruck massiver Unterforderung und nicht böser Wille
- Holt euch Beratung von Spezialisten
Für Berater und Therapeuten:
- Die Arbeit mit höchstbegabten Kindern erfordert ein tiefes Verständnis für ihre spezifische Erlebensweise
- Standard-Ratschläge greifen oft nicht
- Diese Kinder brauchen jemanden, der ihre Komplexität aushält und würdigt
Fazit
Die Unterscheidung zwischen Hochbegabung und Höchstbegabung ist bei Kindern nicht nur sinnvoll, sondern oft entscheidend für ihre gesunde Entwicklung. Es geht nicht darum, Kinder in Schubladen zu stecken oder eine Hierarchie zu schaffen. Es geht darum, die spezifischen Bedürfnisse zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren.
Höchstbegabte Kinder erleben die Welt qualitativ anders als hochbegabte Kinder – intensiver, komplexer, vernetzter. Diese Andersartigkeit anzuerkennen und zu unterstützen, kann den Unterschied machen zwischen einem Kind, das sich falsch und isoliert fühlt, und einem Kind, das seine Begabung als Geschenk erleben kann.
Wenn Du vermutest, dass Dein Kind oder ein Kind in Deinem Umfeld höchstbegabt sein könnte, zögere nicht, professionelle Unterstützung zu suchen. Je früher diese Kinder verstanden und angemessen begleitet werden, desto besser können sie ihre außergewöhnlichen Potenziale entfalten.
Möchtest Du mehr über Dein Kind erfahren oder brauchst Du Unterstützung im Umgang mit Hochbegabung oder Höchstbegabung?
Lass uns darüber sprechen. In meiner Arbeit begleite ich Familien dabei, die Begabung ihrer Kinder zu verstehen und Wege zu finden, wie diese zu einem erfüllenden und freudvollen Leben beitragen kann.
Weiterführende Ressourcen
Wenn du mehr über die Unterschiede zwischen Hochbegabung und Höchstbegabung bei Erwachsenen erfahren möchtest, lies gerne meinen vorherigen Blogbeitrag: Hochbegabung vs. Höchstbegabung: Wo liegt der Unterschied?
Quellen
- Christina Heil (2021): Studie zu hochbegabten Erwachsenen (2021)
- Christina Heil (2021): Studie zu höchstbegabten Erwachsenen (2021)
- Stephanie S. Tolan: „The Deep Inner Experience of Giftedness“
- Linda Silverman: Giftedness 101
- James T. Webb et al.: „Doppeldiagnosen und Fehldiagnosen bei Hochbegabung“
Wünschst Du Dir noch mehr Impulse rund um Hochbegabung, Höchstbegabung, Hochsensibilität und weiteren wunderbaren Themen? Dann stöbere gerne weiter auf meinem Blog: Hier geht’s zu allen Artikeln