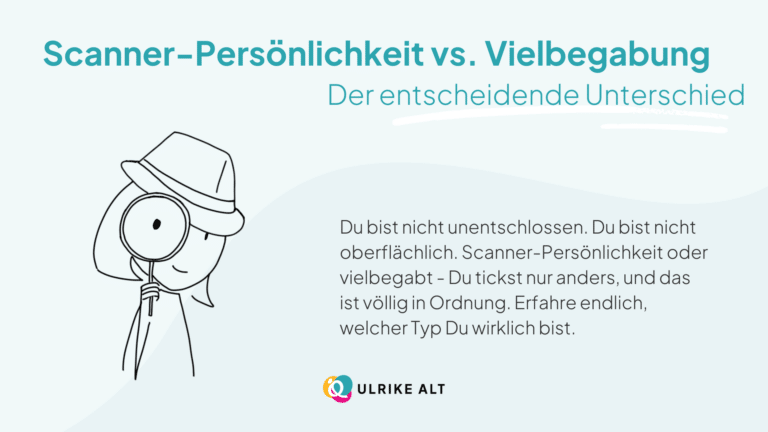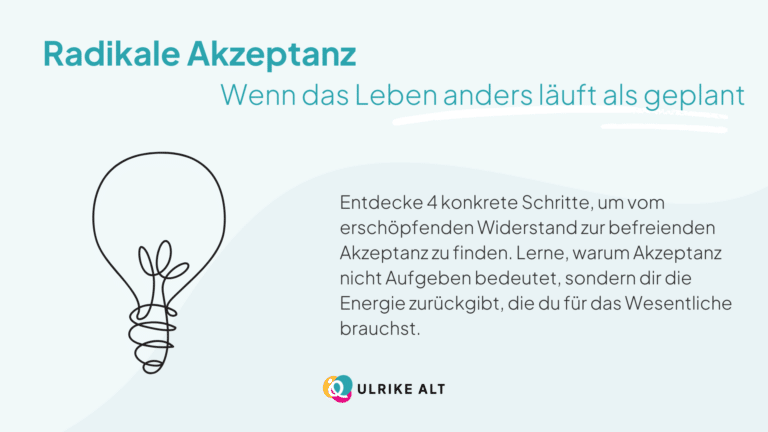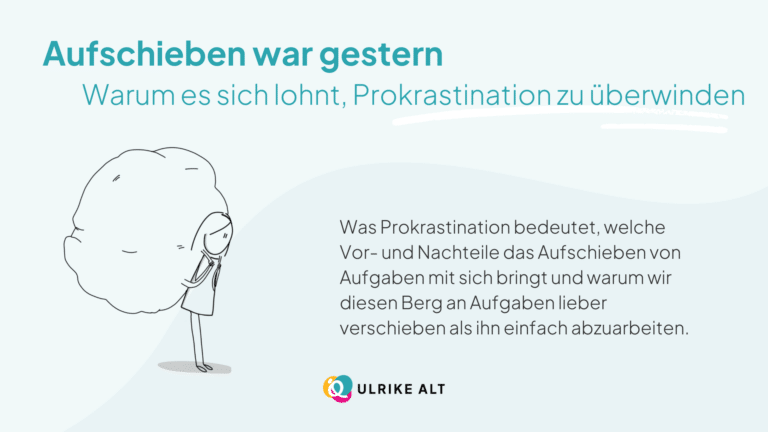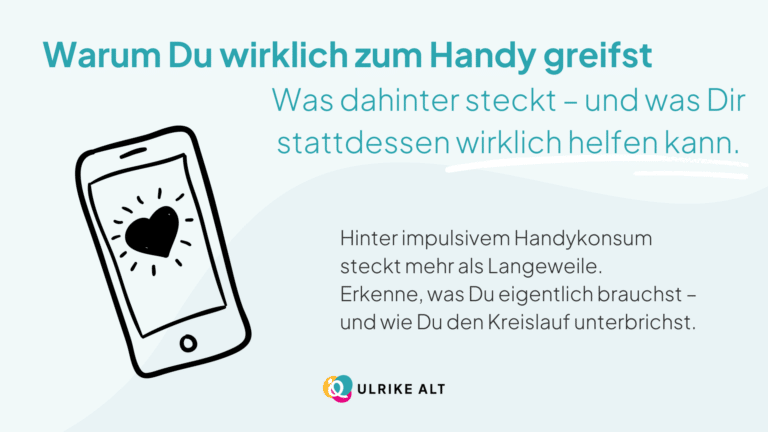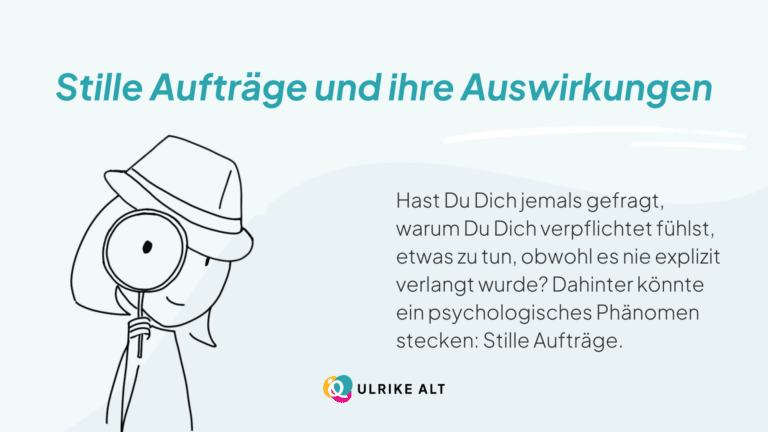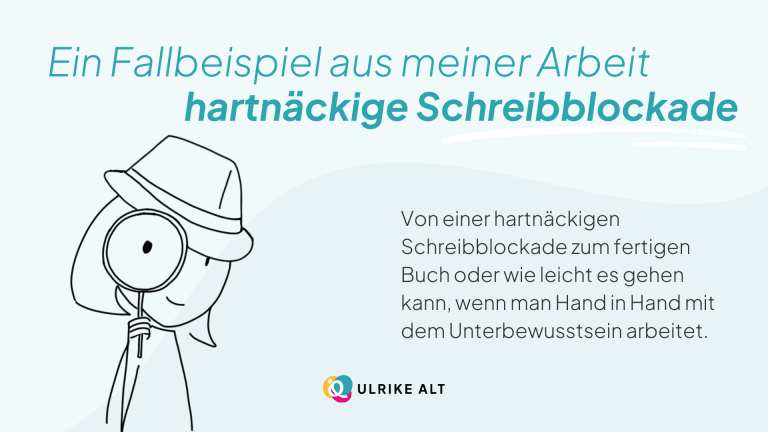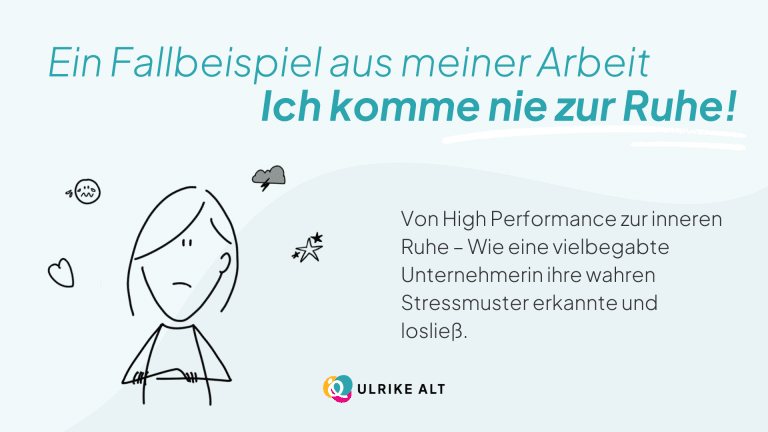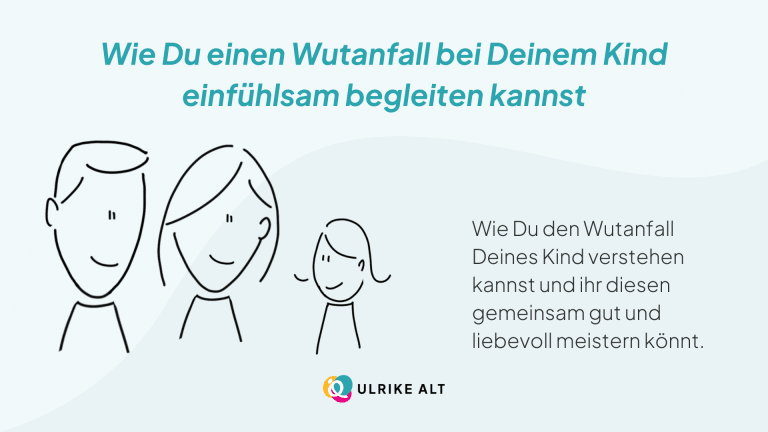Vergebung – der Schlüssel zu Deiner inneren Befreiung
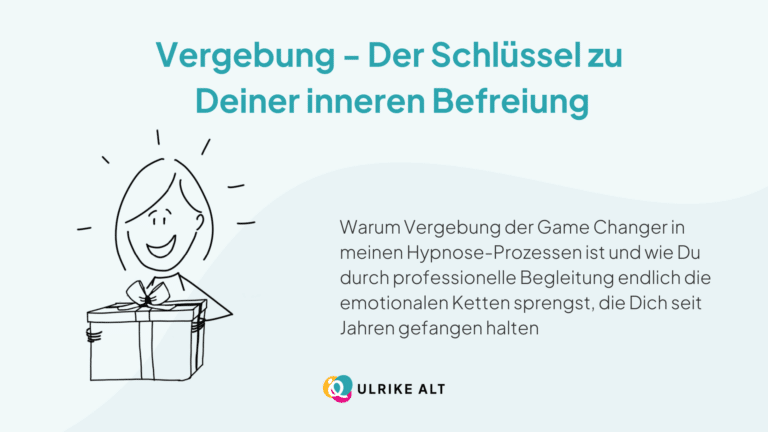
In meiner Arbeit als Hypnose-Coach erlebe ich es immer wieder: Menschen kommen zu mir mit Themen, die sie seit Jahren belasten. Sie haben schon vieles versucht – Gespräche, Therapien, Selbsthilfebücher. Doch da ist noch etwas, das sie innerlich gefangen hält.…